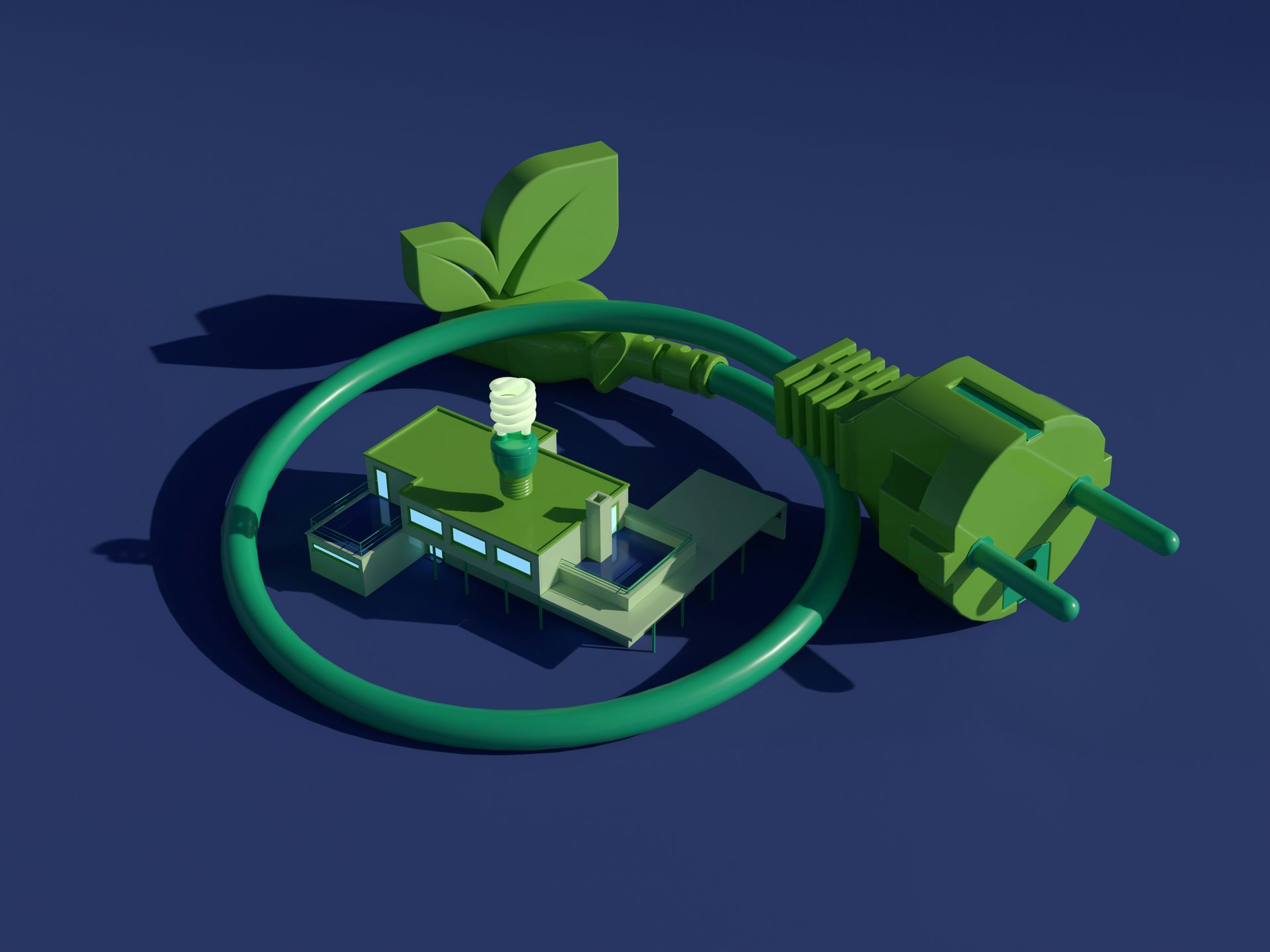Unterschätzte Energiequelle
Neue Studie zeigt Biogaspotenziale
Foto: unsplash
Bis spätestens 2050 soll in Vorarlberg die Energieversorgung auf erneuerbare Energieträger umgestellt sein. Eine neue Studie zeigt nun das Potenzial von Biogas auf.
Bis dato wird in Vorarlberg Biogas, neben zwei Einspeisungen ins Gasnetz, vor allem von in landwirtschaftliche Betriebe integrierten Anlagen produziert. Das Biogas wird dabei in der Regel verstromt und dieser dann eingespeist. Ziel einer neuen Studie war die Ermittlung der wirtschaftlich erschließbaren Biogaspotenziale für Vorarlberg, die Analyse technischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sowie mögliche Erschließungsstrategien, zu eruieren.
Demnach hat die bewährte Stromerzeugung aus Biogas ihre Berechtigung und wird uns als Brückentechnologie noch lange begleiten. Die erneuerbare Stromproduktion aus Wind und PV ist aber schon so kostengünstig, dass sie sich wirtschaftlich durchsetzt. Biogas-Stromgestehungskosten von >20 ct/kWh hingegen können im Strommarkt nur mit massiven Subventionen untergebracht werden.
„Grünes Gas“ gewinnt jedoch an Bedeutung. Dabei steht Biogas im Wettbewerb zu anderen grünen Gasen wie Holzgas und vor allem Wasserstoff. Aus heutiger Sicht kann Biogas (als Rohgas oder auch aufbereitet als Biomethan) am kostengünstigsten hergestellt werden, weshalb die Nachfrage hierfür entsprechend groß sein wird. Der künftige Bedarf in der Industrie wird mit 300 GWh angegeben.
Um einen wirtschaftlichen Betrieb, sprich konkurrenzfähige Endenergiepreise zu ermöglichen, ist eine Mindestgröße der Biogasanlagen erforderlich. Diese liegt deutlich über der Größe der meisten üblichen landwirtschaftlichen Anlagen. Für die Erschließung der Potenziale ist es somit laut Studienautoren essenziell, gemeinsame Biogasanlagen beziehungsweise entsprechende Güllegemeinschaften zu etablieren. Die Kostenanalysen zeigen, dass sich in einem Radius von fünf Kilometern um eine Anlage die Gülle wirtschaftlich sammeln lässt. Unter Nutzung geeigneter bestehender Anlagen wären, um das Potenzial gut abzuschöpfen, etwa zehn neue gemeinschaftliche Anlagen erforderlich.
Die Studienautoren empfehlen deshalb die Entwicklung von Programmen zur Etablierung regionaler gemeinschaftlicher Anlagenstrukturen. Mittelfristige Nutzung bisher exportierter Biomüllaufkommen, Implementierung einer Plattform für Cosubstrate, Aufbereitung und Vermarktung von Gärresten sowie die Analyse der Möglichkeiten der CO2-Abscheidung und Verwertung. (pd)